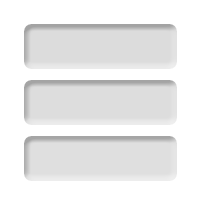Urteile zu PKH/VKH und Beratungshilfe - Herbeiführung vorsätzlicher Vermögenslosigkeit
Verwendung des Erlöses eines Hausverkaufs zur Schuldentilgung
- Die Verwendung des Erlöses aus einem Hausverkauf zur Tilgung eines für den Kauf dieses Hauses aufgenommen Kredits sowie zum Ausgleich des überzogenen Girokontos stellt keine böswillige oder mutwillige Herbeiführung von Leistungsunfähigkeit dar, die zum Versagen von Prozesskostenhilfe führen würde.
OLG Karlsruhe, 03.11.2008, 2 WF 144/08
Aus den Gründen:
I.
Der Antragsgegner beantragt die Bewilligung von Prozesskostenhilfe für die abgetrennten Folgesachen Versorgungsausgleich und Zugewinnausgleich. Ein von ihm im Scheidungsverbundverfahren gestellter Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe ist mit Beschluss des Amtsgerichts vom 22.12.2004 zurückgewiesen worden.
Der Antragsgegner war gemeinsam mit seiner geschiedenen Ehefrau Miteigentümer einer Doppelhaushälfte, die im Zuge der Vermögensauseinandersetzung 2006 verkauft wurde. Einen aus dem Verkaufserlös im Jahr 2006 erhaltenen Betrag in Höhe von 13.500,00 € verwendete der Antragsgegner zur Tilgung eines Kredites bei der Volksbank A.. Nach einem am 16.01.2008 geschlossenen Vergleich erhielt der Antragsgegner von dem hinterlegten Resterlös aus dem Hausverkauf weitere 13.175,00 €.
Am 16.01.2008 hat der Antragsgegner für die noch anhängigen Verfahren betreffend den Zugewinnausgleich und den Versorgungsausgleich die Bewilligung von Prozesskostenhilfe beantragt. Das Amtsgericht - Familiengericht - Baden-Baden hat den Antrag mit Beschluss vom 12.06.2008 zurückgewiesen, weil der Antragsgegner noch Vermögen in Höhe von 13175,00 € aus dem Hausverkauf habe. Zwar berufe er sich darauf, dass sein Girokonto mit mehr als 12.000,00 € überzogen sei. Diese Verbindlichkeiten hätten aber ausweislich der 2004 abgegebenen Erklärung über seine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse damals noch nicht bestanden. In Kenntnis des seit Sommer 2004 anhängigen Scheidungsverfahrens hätte der Antragsgegner keine Schulden begründen dürfen, ohne hinreichende Rücklagen für die zu erwartenden Gerichtskosten zu bilden.
Gegen den am 16.06.2008 zugestellten Beschluss hat der Antragsgegner am 15.07.2008 sofortige Beschwerde eingelegt und vorgetragen, das 2004 bei der Volksbank A. noch mit 13.500,00 € offene Darlehen sei im Zuge des Hausverkaufes abgelöst worden. Zusätzlich sei ein Dispo-Kredit bei der Volksbank A. in Höhe von 3.500,00 € über das Girokonto bei der Volksbank B. getilgt worden. Nach dem Hausverkauf habe er in eine Mietwohnung umziehen müssen. Dafür seien Umzugskosten sowie Kosten für die Renovierung der Wohnung angefallen. Hierdurch habe sich der Sollstand auf dem Girokonto bei der Volksbank B. bis Oktober 2007 auf 12.619,53 € erhöht.
Mit Beschluss vom 17.07.2008 hat das Amtsgericht der Beschwerde nicht abgeholfen. Es hat ausgeführt, der Antragsgegner habe aus dem Hausverkauf Vermögen erworben, das weit über das Schonvermögen hinausgehe. Mit der Verwendung von 13.500,00 € aus dem Verkaufserlös habe er 2006 den Kredit bei der Volksbank A. vor dessen Fälligkeit getilgt, statt dieses Vermögen vorrangig zur Bestreitung der Prozesskosten einzusetzen. Gleiches gelte für den Ausgleich des überzogenen Girokontos bei der Volksbank B. Diese Schulden seien nicht zur Rückzahlung fällig, weshalb sie - unabhängig von ihrem Entstehungsgrund - lediglich in Form von Sollzinsen bei der Bestimmung des verfügbaren Einkommens berücksichtigt werden könnten. Der Antragsgegner habe sein Vermögen ohne Zwang anderweitig eingesetzt und müsse sich daher so behandeln lassen, als stünden ihm die 13.500,00 € und die weiteren 13.175,00 € noch zur Verfügung.
Der Antragsgegner verfolgt die sofortige Beschwerde weiter. Er hat auf gerichtliche Anforderung Kontoauszüge für das Girokonto bei der Volksbank B. vorgelegt. Danach ist dem Konto am 14.02.2008 der Resterlös aus dem Hausverkauf in Höhe von 13.175,00 € gutgeschrieben worden. Das Girokonto wies zum 06.03.2008 einen Sollstand von 3.757,66 € auf.
II.
Die nach § 127 Abs. 2 Satz 2 ZPO zulässige sofortige Beschwerde ist begründet. Dem Antragsgegner ist Prozesskostenhilfe zu bewilligen, weil er nach seinen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen die Kosten der Prozessführung nicht aufbringen kann. Dem steht der zur Kredittilgung verwendete Erlös aus dem Hausverkauf nicht entgegen.
Nach § 115 Abs. 3 ZPO hat die Partei, die Prozesskostenhilfe begehrt, ihr Vermögen einzusetzen, soweit dies zumutbar ist. Gemäß §§ 115 Abs. 3 Satz 2 ZPO i. V. m. 90 SGB XII ist das gesamte verwertbare Vermögen einzusetzen, soweit nicht § 90 Abs. 2 und Abs. 3 SGB XII bestimmte Vermögenspositionen ausnimmt. Maßgeblich ist dabei grundsätzlich das Vermögen zum Zeitpunkt der Antragstellung bzw. der Entscheidung über den Prozesskostenhilfeantrag. Derzeit verfügt der Antragsgegner über kein einsetzbares Vermögen.
Weitere Begründung gemäß § 127 Abs. 1 Satz 3 ZPO nur für den Antragsgegner:
Allerdings hat der Antragsgegner den im Jahr 2006 aus dem Hausverkauf erhaltenen Teilbetrag von 13.500,00 € zur Tilgung eines Kredites bei der Volksbank A. verwendet und mit dem im Februar 2008 erhaltenen Resterlös von 13.175,00 € sein Girokonto bei der Volksbank B. (teilweise) ausgeglichen. Diese beiden Beträge sind ihm bei der Entscheidung über den Prozesskostenhilfeantrag entgegen der Auffassung des Amtsgerichts jedoch nicht als fiktives Vermögen zuzurechnen.
Grundsätzlich ist eine Prozesspartei zwar dazu verpflichtet, eingehendes Kapital für die Prozesskosten zu verwenden. Deshalb kann der Partei fiktives Vermögen zugerechnet werden, soweit sie ihre Leistungsunfähigkeit böswillig oder mutwillig herbeigeführt hat. Dies wird u. a. dann angenommen, wenn mit einer eingehenden Zahlung eine Verbindlichkeit weit vor deren Fälligkeit getilgt wird (BGH FamRZ 1999, 644; OLG Karlsruhe, FamRZ 2008, 1262; 2002, 1196; Stein/ Jonas/ Bork, ZPO, 22. Auflage, § 115 Rdnr.92; Zimmermann, Prozesskostenhilfe, 3. Auflage, Rdnr.154; Kalthoener/ Büttner/ Wrobel-Sachs, Prozesskostenhilfe und Beratungshilfe, 4. Auflage, Rdnr.353).
Den Betrag von 13.500,00 € hat der Antragsgegner im Jahr 2006 dazu verwendet, einen Kredit bei der Volksbank A. zu tilgen. Das Amtsgericht verweist im Nichtabhilfebeschluss zwar richtig darauf, dass dieser Kredit nach dem Vertrag vom 06.09.2004 mit monatlichen Raten in Höhe von 85,00 € und in insgesamt 301 Raten zu tilgen war. Es hat jedoch nicht berücksichtigt, dass der Kredit zur Finanzierung des Erwerbs der selbst genutzten Doppelhaushälfte aufgenommen war, welche im Jahr 2006 im Zuge der Vermögensauseinandersetzung wieder veräußert worden ist. In einem solchen Fall kann die Verwendung eines Teils des Verkaufserlöses zur Tilgung des Kredites nicht als böswillig oder mutwillig angesehen werden. Vielmehr entspricht es wirtschaftlicher Vernunft, einen Immobilienkredit mit dem Verkaufserlös abzulösen, wenn die Immobilie wieder veräußert wird. Die vom Antragsgegner selbst genutzte Doppelhaushälfte musste nach § 90 Abs. 2 Nr. 8 SGB XII nicht als Vermögen eingesetzt werden. So lange die Doppelhaushälfte dem Antragsgegner und seiner Ehefrau gehörte, stand der Kreditverbindlichkeit bei der Volksbank A. wirtschaftlich die Möglichkeit der Nutzung des Hauses gegenüber. Diese Möglichkeit entfiel aber mit dem Hausverkauf, sodass die Tilgung des Kredites trotz des laufenden Gerichtsverfahrens jedenfalls nicht als unangemessene oder böswillige Ausgabe angesehen werden kann.
Auch der im Jahr 2008 dem Girokonto bei der Volksbank B. gutgeschriebene Betrag von 13175,00 € kann nicht als fiktives Vermögen gegen die Bedürftigkeit des Antragsgegners berücksichtigt werden. Der Antragsgegner hat durch Vorlage des Kontoauszugs glaubhaft gemacht, dass sein Girokonto zum 31.12.2007 einen Sollstand von 1.0897,71 € aufwies. Damit war das aus dem Kontoauszug ersichtliche Kreditlimit von 5.000,00 € weit überschritten. Auch nach der Gutschrift der 13.175,00 € zum 14.02.2008 verblieb das Konto im Soll und wies zum 06.03.2008 einen Sollstand von 3.757,66 € auf. Damit gab und gibt es kein Vermögen, welches der Antragsgegner zur Finanzierung der Prozesskosten hätte einsetzen können. Bei der Prüfung, ob ein nach § 115 Abs. 3 ZPO einsetzbares Vermögen vorhanden ist, müssen Plus- und Minuspositionen einander gegenübergestellt werden. Wenn wie hier die Verbindlichkeiten der Partei ihre verwertbaren Vermögenswerte übersteigen, so braucht sie eingehendes Geld grundsätzlich nicht zur Zahlung der Prozesskosten zu verwenden (vgl. BAG, ArbRB 2006, 109). Keine Partei ist nach § 115 ZPO dazu verpflichtet, einen Kontokorrent-Kredit für die Prozesskosten aufzunehmen (OLG Karlsruhe, FamRZ 2004, 1499; Zöller/Philippi, ZPO, 26. Auflage, § 115 Rn. 63). Daher kann es auch nicht als mutwillige Herbeiführung der Bedürftigkeit bewertet werden, wenn der aus dem Hausverkauf eingehende Erlös zum (teilweisen) Ausgleich eines überzogenen Girokontos verwendet wurde.
Nach den Abzügen gemäß § 115 Abs. 1 ZPO verbleibt dem Antragsgegner kein einzusetzendes Einkommen. Ihm ist daher ab dem Zeitpunkt der Antragstellung ratenfreie Prozesskostenhilfe zu bewilligen.
Quelle:
.
Bitte zögern Sie nicht! Die eigenständige Beantragung von Verfahrenskostenhilfe ist voller Fallstricke. Kennen Sie diese nich, kann Ihr gesamtes, berechtigtes, Anliegen scheitern. Besonders der geforderte Antrag hat es in sich - er ist praktisch die Klageeinreichung und damit der Schlüssel zum Erfolg Ihres Verfahrens (oder auch zum Misserfolg). Auch ist der Antrag immer dann umso bedeutender, je höher der Streitwert ist. []
Bedenken bezüglich der Finanzierung des ersten Anwaltsbesuchs zur Besprechung des Verfahrens unter Zuhilfenahme von Verfahrenskostenhilfe sollten Sie nicht haben: Diese Konsultation wird mit über die Verfahrenskostenhilfe finanziert.
Möchten Sie das Finanzielle betreffend ganz sicher gehen, empfiehlt es sich, dass Sie selbstständig Beratungshilfe für diesen ersten Anwaltsbesuch beantragen.
[ weiter ]
• Kapitel "Einkommen bei PKH, VKH und Beratungshilfe"
• Kapitel "Vermögen bei PKH, VKH und Beratungshilfe"
• Kapitel "Pkw/Auto bei PKH, VKH und Beratungshilfe"
• Kapitel "Prozess- und Verfahrenskostenvorschuss bei PKH und VKH"
• Kapitel "Rechner für PKH, VKH und Beratungshilfe"
• Kapitel "Gesetzestexte zu Einkommen und Vermögen bei PKH, VKH und Beratungshilfe"
• Kapitel "Urteile zur Einkommesberechnung PKH, VKH und Beratungshilfe"
• Kapitel "Urteile zum Vermögen bei PKH, VKH und Beratungshilfe"
• Inhaltsverzeichnis