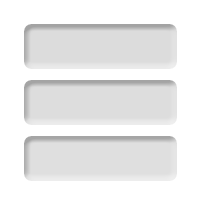Das Bundesverfassungsgericht zur PKH und VKH bei Scheinehe - Pflicht der Rücklagenbildung
Wir stellen hier 2 richtungsweisende Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zur Scheinehe und Verfahrenskostenhilfe (ehemals Prozesskostenhilfe) vor. Beide Urteile haben die Genehmigungspraxis maßgeblich beeinflusst.
Die Beurteilung der Leistungshähigkeit einer Partei bei der Entscheidung über einen Prozesskostenhilfeantrag (ZPO § 114) obliegt grundsätzlich den dafür allgemein zuständigen Gerichten.
BverfG, 1 BvR 446/84 vom 18.07.1984
Der Sachverhalt:
Die Beschwerdeführerin (Bf.) hatte zur Scheidung einer Scheinehe Prozesskostenhilfe (PKH) beantragt, die ihr nicht gewährt wurde. Die Begründung lautet, sie, die Bf., hätte von den für die Scheinehe erhaltenen 8.000 DM Rücklagen für die Scheidung der Scheinehe bilden müssen, zumal Sie schon vorher eine andere Scheinehe eingegangen war. Gegen diese Zurückweisung Ihres Antrags auf PKH wendet Sie sich mit dieser Verfassungsbeschwerde.
Aus den Gründen:
Die Verfassungsbeschwerde ist unbegründet.
1. Die Rechtsprechung der Gerichte zur PKH bei der Scheidung von Scheinehen ist nicht einheitlich. Dabei stellt die Auseinandersetzung mit der RechtsmiZbräuchlichkeit des Eingehens einer Scheinehe und ihre Auswirkung auf das PKH-Begehren für die anschließende Scheidung der Ehe die zentrale Frage dar (vgl. etwa OLG Köln - 21. Zivilsenat -, FamRZ 1983, 592; OLG Hamburg, FamRZ 1983, 1230; OLG Köln - 4. Zivilsenat -, FamRZ 1984, 278; OLG Celle, FamRZ 1984, 279). Die Verfassungsbeschwerde gibt indessen keine Veranlassung, auf diese Problematik einzugehen; denn die Gerichte haben hier letztlich darauf abgestellt, dass es der Bf. zuzumuten sei, die Kosten für das Scheidungsverfahren selbst aufzubringen. Dabei sind sie davon ausgegangen, dass die Bf. mit einem alsbaldigen Scheidungsverfahren wegen der von ihr geschlossenen Scheinehe habe rechnen können und daher von den für die Eheschließung gezahlten 8.000 DM einen entsprechenden Betrag für die Scheidungskosten hätte zurückbehalten können und müssen. Diese Rechtsauffassung mag mit der herrschenden Meinung zur Versagung von PKH bei verschuldeter Hilfsbedürftigkeit nicht übereinstimmen, nach der PKH-Anträge nur dann abgelehnt werden könnten, wenn sich die Partei böswillig arm gemacht habe (vgl. OLG Köln, FamRZ 1983, 635 m. w. N.). Hier handelt es sich aber um die Auslegung des § 114 ZPO, über deren Richtigkeit im Sinne einer Billigkeit sich sicher streiten lässt. Diese Auslegung obliegt den zuständigen Gerichten (vgl. BVerfGE 18, 85[93]). Es kann nicht Aufgabe des BVerfG sein, nach Art einer Revisionsinstanz seine Vorstellung von einer zutreffenden Entscheidung an die des ordentlichen Gerichts zu setzen. Beschlüsse im PKH-Verfahren sind vielmehr nur daraufhin zu überprüfen, ob sie auf einer grundsätzlich unrichtigen Anschauung von der Bedeutung des Art. 3 I GG beruhen (vgl. BVerfGE 7, 53[56] = FamRZ 1957, 360 Nr. 167 [LSe.]; BVerfGE 42, 143 [148]). Das ist hier nicht der Fall.
Die Gerichte haben zudem in von Verfassungs wegen nicht zu beanstandender Weise bei ihrer Abwägung mit berücksichtigt, dass die Bf. das zweite Mal eine Scheinehe mit einem Ausländer eingegangen ist und sie bereits im ersten Scheidungsverfahren auf ihre grundsätzliche Verpflichtung zur Finanzierung des Prozesses hingewiesen wurde. Unter diesen Umständen verstößt es nicht gegen Art. 3 I GG, dass der PKH-Antrag der Bf. abgewiesen worden ist.
2. Daneben scheidet eine Prüfung am Maßstab des Art. 6 I GG aus. Es geht ausschließlich darum, ob die Bf. in einer mit dem Grundsatz der Rechtsanwendungsgleichheit zu vereinbarenden Weise an der Durchsetzung ihres Scheidungsbegehrens gehindert ist.
Abgedruckt in: NJW 1985, 425 ff., FamRZ 1984, 1205 ff.
Zur verfassungsrechtlichen Nachprüfung von Entscheidungen der ordentlichen Gerichte im Prozesskostenhilfeverfahren bei "Scheinehe".
BverfG, 1 BvR 1455/83 vom 18.07.1984
Der Sachverhalt:
Die Beschwerdeführerin (Bf.) hatte zur Scheidung einer Scheinehe Prozesskostenhilfe (PKH) beantragt die ihr nicht gewährt wurde. Die Begründung lautet, sie, die Bf., hätte den für die Scheinehe vereinbarten Betrag nicht erhalten und sei damit mittellos. Trotzdem wurde Ihr PKH mit der Begründung versagt, Sie hätte die Notwendigkeit der Inanspruchnahme von PKH selber schuldhaft herbeigeführt. Gegen diese Zurückweisung Ihres Antrags auf PKH wendet Sie sich mit dieser Verfassungsbeschwerde.
Aus den Gründen:
Es kann nicht festgestellt werden, dass die angegriffenen Entscheidungen Grundrechte der Bf. verletzen (§ 15 II S. 4 BVerfGG).
1. Die rechtlichen Vorschriften für die Durchführung eines Verfahrens vor den Zivilgerichten und damit die Regelungen über die Ehescheidung gelten für alle Bürger in gleicher Weise; es gilt gleiches Recht, gleichgültig, ob eine Partei vermögend oder arm ist. Die Verwirklichung dieser rechtlichen Gleichheit ist aber im Falle wirtschaftlichen Unvermögens in Frage gestellt. Deshalb hat der Gesetzgeber dafür Sorge zu tragen, dass auch die ,,arme" Partei in die Lage versetzt wird, ihre Belange in einer dem Gleichheitsgebot gemäßen Weise im Rechtsstreit geltend zu machen. Dies ist in der Form der staatlichen PKH geschehen (vgl. BVerfGE 35, 348 [3551]).
Ob die Gerichte bei ihren Entscheidungen die allgemeinen Gesetze richtig anwenden oder auslegen, hat das BVerfG grundsätzlich nicht nachzuprüfen; dies gilt auch für Beschlüsse im PKH-Verfahren. Das BVerfG kann erst eingreifen, wenn die Entscheidungen, mit denen Antrage auf PKH abgelehnt wurden, auf einer grundsätzlich unrichtigen Anschauung von der Bedeutung der Rechtsanwendungsgleichheit als einer Grundforderung des Rechtsstaates beruhen.
2. Die Rechtsprechung der Gerichte zur PKH bei der Scheidung von Scheinehen ist nicht einheitlich. Dabei stellt die Auseinandersetzung mit der Rechtsmißbräuchlichkeit des Eingehens einer Scheinehe und ihre Auswirkung auf das PKH-Begehren für die anschließende Scheidung der Ehe die zentrale Frage dar (vgl. etwa OLG Köln- 21. Zivilsenat -, FamRZ 1983, 592; OLG Hamburg, FamRZ 1983, 1230; OLG Köln - 4. Zivilsenat -, FamRZ 1984, 278; OLG Celle, FamRZ 1984,279).
a) Nach Ansicht von vier Richtern, deren Auffassung die Entscheidung trägt, gibt die Verfassungsbeschwerde keinen Anlass, auf diese Problematik einzugehen; denn die Gerichte haben letztlich darauf abgestellt, die Bf. hätte für ihre Leistungsfähigkeit Sorge tragen müssen und dies schließe die Gewährung von PKH aus. Bei dieser Beurteilung handelt es sich um die Auslegung des einfachen Rechts und seine Anwendung auf den einzelnen Fall, ohne dass die Entscheidungen auf einer grundsätzlich unrichtigen Anschauung von der Bedeutung eines Grundrechts, insbesondere vom Umfang seines Schutzbereichs, beruhen (vgl. BVerfGE 18, 85 [93]; BVerfG, Beschluß V. 18.7. 1984 - 1 BvR 4461/84 - [vorstehend Nr. 667]).
Das Amtsgericht geht in seiner Entscheidung davon aus, die Bf. habe sich ihre Bereitschaft zur Eheschließung mit einem nicht näher dargelegten Betrag bezahlen lassen. Diese Feststellung ist nicht zu beanstanden. Das OLG hat in seinem Beschluss zwar erwähnt, dass die Bf, bestritten habe, einen versprochenen Geldbetrag erhalten zu haben. Aber auch dieses Gericht hat die Verpflichtung der Bf. zur Bildung von Rücklagen für ihr Ehescheidungsverfahren betont. In diesem Zusammenhang hat es auf einen Beschluss des OLG Celle (FamRZ 1983, 593) Bezug genommen, der in einem Fall
ergangen ist, in dem für das Eingehen einer Scheinehe Zahlungen geleistet wurden. Es kann daher aus dem Zusammenhang der Begründung entnommen werden, dass das
OLG dem Vortrag der Bf. über das Ausbleiben der Zahlungen keinen Glauben geschenkt hat. Nach O 286 ZPO entscheidet das Gericht nach freier Überzeugung, ob eine tatsächliche Behauptung wahr ist oder nicht, so dass auch insoweit Verfassungsrecht nicht verletzt ist. Wenn sich die Gerichte in ihren Entscheidungen nicht mit der Relation
zwischen der Höhe des gezahlten Betrages und der Möglichkeit, daraus Rücklagen zu bilden, auseinandergesetzt haben, so liegt das an dem pauschalen Bestreiten der Bf., überhaupt Geld für die Bereitschaft zur Eingehung der Scheinehe empfangen zu haben.
b) Nach Ansicht der vier anderen Richter reicht die Begründung der angegriffenen Entscheidungen nicht für die Annahme aus, die Bf. hätte ihr Scheidungsverfahren in zumutbarer Weise selbst finanzieren können:
Die Bf. beanstandet zutreffend, das OLG habe nicht einmal ansatzweise dargetan, wieso sie zur Bildung von Rücklagen in der Lage gewesen sein solle. Demgemäß beruhen die Entscheidungen beider Instanzen im Ergebnis auf dem Vorwurf, die Bf. habe das Rechtsinstitut der Ehe missbraucht und deshalb dürfe der Steuerzahler nicht mit den Kosten für das Scheidungsverfahren belastet werden.
Damit lehnt das Gericht die Gewährung von PKH aus Gründen ab, die im Gesetz und in der sonstigen Rechtsprechung zur Zahlung von PKH keine Stütze finden. Nach § 114 ZPO ist neben den wirtschaftlichen Verhältnissen des Antragstellers die hinreichende Erfolgsaussicht für die Entscheidung über den PKH-Antrag maßgeblich. Dass insoweit die Voraussetzungen für die Gewährung von PKH bei der Bf. vorliegen, ist offensichtlich; Anhaltspunkte für eine mutwillige Prozessführung sind nicht gegeben. Weitere Versagungsgründe sieht § 114 ZPO nach seinem Wortlaut nicht vor. Den Gerichten obliegt es zwar, die Gesetze auszulegen; auch die richterliche schöpferische Rechtsfindung ist von Verfassungswegen nicht schon grundsätzlich zu beanstanden. Diese Befugnis besteht aber nicht uneingeschränkt (vgl. BVerfGE 49, 304 [318]); sie findet jedenfalls dort ihre Grenze, wo ein Gericht von Erwägungen ausgeht, die Grundrechte oder diesen gleichgestellte Rechte verletzen (vgl. BVerfGE 7, 53 [56j = FamRZ 1957, 360 Nr. 167 [LSe.]). Das ist hier der Fall.
Die Begründung des OLG führt dazu, dass die bedürftige Partei unter Verletzung des Grundsatzes der Rechtsanwendungsgleichheit schlechter gestellt wird als die nicht bedürftige. Da rechtsmissbräuchlich zwar die Eingehung einer Scheinehe, nicht aber deren Scheidung ist, wäre eine reiche Partei nicht gehindert, im Wege des gesetzlich vorgeschriebenen Ehescheidungsverfahrens eine Aufhebung einer Scheinehe zu erreichen. Die arme Partei wird hingegen an der Scheinehe festgehalten. Diese Schlechterstellung lässt sich im vorliegenden Fall um so weniger rechtfertigen, als die Bf. dadurch gehindert wird, ihre Eheschließungsfreiheit wiederzuerlangen und den Vater ihres nichtehelichen Kindes zu heiraten. Wenn die staatliche Rechtsordnung die Aufhebung einer Scheinehe trotz deren Missbilligung von der Durchführung eines Kosten verursachenden Verfahrens abhängig macht, sind einer bedürftigen Partei grundsätzlich die dafür erforderlichen Mittel zu bewilligen, wenn die gesetzlich vorgesehenen Voraussetzungen für diese Bewilligung vorliegen.
Abgedruckt in: FamRZ 1984, 1206 ff. und NJW 1985, 425
.
Bitte zögern Sie nicht! Die eigenständige Beantragung von Verfahrenskostenhilfe ist voller Fallstricke. Kennen Sie diese nich, kann Ihr gesamtes, berechtigtes, Anliegen scheitern. Besonders der geforderte Antrag hat es in sich - er ist praktisch die Klageeinreichung und damit der Schlüssel zum Erfolg Ihres Verfahrens (oder auch zum Misserfolg). Auch ist der Antrag immer dann umso bedeutender, je höher der Streitwert ist. []
Bedenken bezüglich der Finanzierung des ersten Anwaltsbesuchs zur Besprechung des Verfahrens unter Zuhilfenahme von Verfahrenskostenhilfe sollten Sie nicht haben: Diese Konsultation wird mit über die Verfahrenskostenhilfe finanziert.
Möchten Sie das Finanzielle betreffend ganz sicher gehen, empfiehlt es sich, dass Sie selbstständig Beratungshilfe für diesen ersten Anwaltsbesuch beantragen.
[ weiter ]
• Kapitel "Einkommen bei PKH, VKH und Beratungshilfe"
• Kapitel "Vermögen bei PKH, VKH und Beratungshilfe"
• Kapitel "Pkw/Auto bei PKH, VKH und Beratungshilfe"
• Kapitel "Prozess- und Verfahrenskostenvorschuss bei PKH und VKH"
• Kapitel "Rechner für PKH, VKH und Beratungshilfe"
• Kapitel "Gesetzestexte zu Einkommen und Vermögen bei PKH, VKH und Beratungshilfe"
• Kapitel "Urteile zur Einkommesberechnung PKH, VKH und Beratungshilfe"
• Kapitel "Urteile zum Vermögen bei PKH, VKH und Beratungshilfe"
• Inhaltsverzeichnis