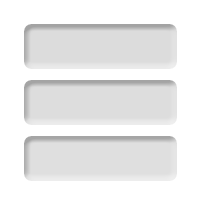Übersicht: Ablehnung von PKH/VKH und Möglichkeiten, sich gegen die ergangene PKH/VKH-Entscheidung zu wehren:
- Folgen einer Ablehnung - "wie oft" kann man einen PKH/VKH-Antrag stellen?
- Die sofortige Beschwerde
- Die Rechtsbeschwerde
- Die Gegenvorstellung/Rüge
Ablehnung von PKH/VKH und Möglichkeiten, sich gegen die ergangene PKH/VKH-Entscheidung zu wehren
Folgen einer Ablehnung - "wie oft" kann man einen PKH/VKH-Antrag stellen?
Direkte Folge einer Ablehnung von PKH/VKH ist, dass Sie den Prozess wie jede andere Person auch bestreiten müssen.
Sie können aber, neben den unten beschriebenen Rechtsmitteln gegen eine Ablehnung, einen neuerlichen Antrag auf PKH/VKH stellen. Es gibt keine Regelung, die vorschreibt, "wie oft" sie für ein und dieselbe Sache PKH/VKH beantragen können. Lediglich das Betreiben der Hauptsache wird dem unweigerlich (zeitliche) Grenzen setzen (s. "Nachträgliche Beantragung von PKH/VKH").
Zu beachten ist aber: Stellen Sie wiederholt einen PKH/VKH-Antrag, entfaltet dieser keine rückwirkende Wirkung. Das ist im Unterschied zum ersten PKH/VKH-Antrag, der Rückwirkung entfalten kann. Praktisch heißt das: Der erste PKH/VKH-Antrag kann derart beschieden werden, dass Ihnen auch Kosten im Zusammenhang mit diesem Verfahren, die vor Antragstellung angefallen sind, erstattet werden können - nicht aber bei einem Wiederholungsnatrag. Auch wird die durch den ersten PKH/VKH-Antrag eingetretene Hemmung der Verjährung nicht durch nachfolgende Anträge verlängert (s.u. "PKH/VKH-Antrag und Verjährung der Hauptsache"). Daher kann es problematisch sein, wenn Fristen in dem Verfahren, für welches PKH/VKH beantragt werden soll, einzuhalten sind - Sie können daher mit mehreren Anträgen Gefahr laufen, dass Ihnen die Zeit für das Hauptsacheverfahren davon läuft.
Keinen neuen Antrag werden Sie stellen können, wenn Sie mehrfach gegenüber dem Gericht falsche Angaben gemacht haben. Auch ein und denselben Antrag nach Ablehnung unverändert nochmals einzureichen wird dazu führen, dass er nicht erfolgreich sein wird. Genauso erfolglos wird es sein, stellt das Gericht fest, dass bei Antragswiederholung behauptete Tatsachen offensichtlich nur vorgeschoben sind.
Eine mögliche Begründung für einen neuen Antrag wäre aber beispielsweise, wenn sich zwischen Ablehnung und Neubeantragung die Rechtssprechung an einem für die Ablehnung entscheidenden Punkt verändert hat - dann reicht es auch, den alten Antrag nochmals einzureichen und auf diesen Fakt hinzuweisen.
Die sofortige Beschwerde
Ob Sie sich gegen eine Ihnen nachteilig erscheinende PKH/VKH-Bewilligung wehre können, hängt davon ab, wogegen Sie sich genau wehren wollen. Ein Anwaltszwang für diesen Rechtszug besteht nicht. Zu den Ihnen daraus entstehenden Kosten siehe "PKH/VKH und Kosten - Antrag auf PKH/VKH". Immer beschweren können Sie sich gegen aus Ihrer Sicht falsche Entscheidungen zu Ihren persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen.
Wollen Sie sich gegen etwas anderes als die Beurteilung Ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse wehren, müssen Sie auf den Streitwert der Hauptsache achten. Ist die Hauptsache bereits anhängig, ergibt sich der Streitwert aus dieser, ist sie noch nichts anhängig, ergibt sich der Streitwert aus Ihrem Anliegen ("Darstellung des Streitgegenstands"). Unerheblich ist, ob Sie nur eine Teilbewilligung erhalten haben oder nur teilweise PKH/VKH beantragt haben - maßgeblich ist immer der volle Streitwert, nicht der Teilstreitwert, auf den sich die PKH/VKH bezieht. Dieser Streitwert muss über dem Mindestwert des Beschwerdegegenstandes nach Abs.1, Nr. 1 von aktuell 600,00 Euro liegen.
Grundsätzlich keine Möglichkeit der Beschwerde haben Sie, wenn das Hauptsacheverfahren nicht anfechtbar ist (beispielsweise eine gerichtliche Anordnung zum Kindesunterhalt). Es kann jedoch Ausnahmen bzgl. des Grundes der Anfechtung geben, wenn sich mit Ihrer Beschwerde etwa gegen die Entscheidung zu Anwaltsbeiordnung wehren möchten (BGH, 18.05.2011, XII ZB 265/10).
Damit Sie sich beschweren können, muss es einen greifbaren Beschwerdegrund geben, die sogenannte Beschwer. Folgende Beispiele für eine Beschwer seien zur Illustration genannt: die Aufhebung der Bewilligung, die Festsetzung von Monatsraten, die Festsetzung von Zahlungen aus dem Vermögen, eine vorläufige Begrenzung der Anzahl der Monatsraten, die Ablehnung der Beiordnung eines Rechtsanwaltes, die Beiordnung eines von Ihnen nicht beauftragten Rechtsanwaltes, eine Ablehnung der Aufhebung der Ratenzahlung, die Weigerung über Ihren PKH-Antrage zu entscheiden, die Ablehnung der Entpflichtung eines Anwaltes, die Beweiserhebung bereits im PKH/VKH-Verfahren. Auch gegen die Beiordnung eines Anwaltes nur zu den Bedingungen eines ortsansässigen Anwalts können Sie Beschwerde einlegen (OLG Rostock, 17.01.2011, 1 W 53/09), was jedoch kontrovers gesehen wird (KG, 23.02.2011, 19 WF 14/11); Ihr Anwalt kann dagegen jedoch unbestritten Beschwerde einlegen.
Keine Beschwerde können Sie gegen die Bewilligung von PKH/VKH an sich einlegen. Ausnahme ist nur, wenn ein Dritter in Ihrem Nahmen und gegen Ihren Willen einen Prozess führen möchte und dafür PKH/VKH beantragt.
Die Folge, wenn Sie Beschwerde einlegen, ist, dass das Hauptsacheverfahren, so es bereits läuft, pausiert werden muss und erst über Ihre Beschwerde zu entschieden ist. Entscheidet das Gericht nicht über Ihre Beschwerde, ist auch dies beschwerdefähig.
Ihr Prozessgegner hat bezüglich Ihrer PKH/VKH-Bewilligung kein Beschwerderecht. Jedoch könnte er sich beschweren, wenn er, während Sie PKH/VKH erhalten, den Vorschuss an das Gericht trotzdem zahlen muss (ZPO § 122 Abs. 2).
Die Frist zur Einreichung Ihrer Beschwerde beträgt 1 Monat. Dabei handelt es sich um eine sog. Notfrist, da die Dauer abgeleitet und nicht speziell im Gesetz festgelegt ist. Dass Sie 1 Monat, und nicht, wie bei den meisten Notfristen üblich, nur 2 Wochen Zeit haben begründet sich damit, dass das, wogegen Sie sich wehren, für Sie negative Auswirkungen hat und die Notfrist für ein für Sie negatives Urteil eben 1 Monat beträgt.
Bekommen Sie einen PKH/VKH-Beschluss nicht zugestellt, kommt die Regelung zur Anwendung, dass der Beschluss 5 Monate nach Verkündung (was hier der Zustellung entspricht) bestandskräftig wird - also nach 6 Monaten (5 Monate + 1 Monat) nicht mehr mit einer Beschwerde angefochten werden kann. Allerdings wurde auch schon entschieden, dass eine Beschwerde bei Nichtzugang auch noch nach über 2 Jahren möglich ist (BGH, 30.11.2010, VI ZB 30/10).
Der rechtskräftige Abschluss des Hauptverfahrens bedeutet nicht automatisch, dass Sie sich gegen den PKH/VKH-Bescheid dazu nicht mehr wehren können.
Hinsichtlich der Entscheidung des Beschwerdegerichts ist wichtig zu wissen, dass auch hier das allgemeine juristische Prinzip des Verschlechterungsverbots (reformatio in peius) gilt: Beschweren Sie sich beispielsweise über die Höhe der festgesetzten Raten, das Beschwerdegericht kommt aber zur Ansicht, dass Ihr Antrag prinzipiell hätte erst gar nicht bewilligt werden dürfen, kann es Ihre Beschwerde nur zurückweise - nicht aber PKH/VKH an sich aufheben.
Die Rechtsbeschwerde
Eine Rechtsbeschwerde gegen eine Entscheidung des Beschwerdegerichts ist nur möglich, wenn das Beschwerdegericht diese ausdrücklich zulässt. Erfolg diese Zulassung nicht, sind Ihre Möglichkeiten erschöpft. Keine Äußerung des Beschwerdegrichts über eine mögliche Rechtsbeschwerde gilt als Ablehnung. Als letzte Möglichkeit bleibt Ihnen dann nur noch die Gegenvorstellung. Prinzipiell kann eine Rechtsbeschwerde aber auch nur dann zugelassen werden, wenn es um Fragen das Verfahren an sich oder die Beurteilung Ihrer persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geht. Wird aber Rechtsbeschwerde bewilligt, kann dafür, entgegen des Grundsatzes "keine PKH für PKH", PKH bewilligt werden.
Die Gegenvorstellung/Rüge
Sind Sie der Ansicht, dass die Ablehnung Ihrer sofortigen Beschwerde gegen allgemeine Rechtsgrundsätze verstößt, also ein Verfahrensfehler vorliegen, ist die Gegenvorstellung an das Beschwerdegericht möglich. Ein Mindeststreitwert ist dazu nicht festgelegt. Sie müssen aber die gesetzte Frist von 2 Wochen einhalten ( Abs. 2).
Wird Ihre Gegenvorstellung zurückgewiesen, sind damit Ihre Rechtsmittel erschöpft.
.
Bitte zögern Sie nicht! Die eigenständige Beantragung von Verfahrenskostenhilfe ist voller Fallstricke. Kennen Sie diese nich, kann Ihr gesamtes, berechtigtes, Anliegen scheitern. Besonders der geforderte Antrag hat es in sich - er ist praktisch die Klageeinreichung und damit der Schlüssel zum Erfolg Ihres Verfahrens (oder auch zum Misserfolg). Auch ist der Antrag immer dann umso bedeutender, je höher der Streitwert ist. []
Bedenken bezüglich der Finanzierung des ersten Anwaltsbesuchs zur Besprechung des Verfahrens unter Zuhilfenahme von Verfahrenskostenhilfe sollten Sie nicht haben: Diese Konsultation wird mit über die Verfahrenskostenhilfe finanziert.
Möchten Sie das Finanzielle betreffend ganz sicher gehen, empfiehlt es sich, dass Sie selbstständig Beratungshilfe für diesen ersten Anwaltsbesuch beantragen.
• Kapitel "Erfolgsaussichten und Mutwilligkeit"
• Kapitel "Wer zahlt was? - PKH/VKH und Kosten"
• Kapitel "Der Antrag auf PKH/VKH"
• Kapitel "Das PKH/VKH-Prüfungsverfahren"
• Kapitel "Bewilligung - die Entscheidung über PKH und VKH"
• Kapitel "Überprüfung und Revision der PKH/VKH-Bewilligung - Mitteilungspflicht"
• Kapitel "Aufhebung der Bewilligung von PKH/VKH"
• Kapitel "Abgelehnter/abgewiesener PKH/VKH-Antrag: Beschwerde und Frist"
• Kapitel "PKH/VKH und Anwaltsbeiordnung sowie Anwaltswechsel"
• Kapitel "Verfahrenskostenhilfe (VKH) - PKH im Familienrecht"
• Kapitel "PKH für Verfahren außerhalb des Familienrechts"
• Kapitel "Gesetzestexte zu Prozesskostenhilfe (PKH) und Verfahrenskostenhilfe (VKH)"
• Kapitel "Urteile zu Prozesskostenhilfe (PKH) und Verfahrenskostenhilfe (VKH)"
• Kapitel "Bescheide PKH/VKH - Beispiele"
• Inhaltsverzeichnis