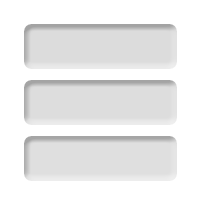Übersicht: Der Antrag auf Prozesskostenhilfe (PKH)/ Verfahrenskostenhilfe (VKH):
- Formularzwang
- Einzureichende Unterlagen
- Einsichtmöglichkeiten des Prozessgegners in die Unterlagen über die Einkommens- und Vermögensverhältnisse
- PKH/VKH-Antrag und (un)bedingte Klageerhebung
- PKH/VKH-Antrag und Verjährung der Rechtsverfolgung
- Nachträgliche Beantragung von PKH/VKH - PKH/VKH für Beklagte
Der Antrag auf Prozesskostenhilfe (PKH)/ Verfahrenskostenhilfe (VKH) - Einzureichende Unterlagen
Unterlagen über die Einkommens- und Vermögensverhältnisse
Was und wie etwas im Formular über die "wirtschaftlichen Verhältnisse" anzugeben ist, haben wir in den Kapiteln "Einkommen" und "Vermögen" dargestellt (sie können auch direkt zum PKH-/VKH-Rechner gehen und dort die Links neben den Eingabefeldern zu den entsprechenden Erklärungen nutzen). Das Machen falscher Angaben kann strafbar sein, und als Betrug gewertet werden.
Alle gemachten Angaben zu Einkommen und Vermögen sind zu belegen. Die Belege dazu sollen einen längeren Zeitraum umfassen, damit auch ggf. Sonderzuwendungen erfasst werden können. Geeignete Belege sind beispielsweise: Steuer- oder Verdienstbescheide, Bescheide über Rente, Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe sowie Kontoauszüge. Das teilweise Schwärzen von Unterlagen, z.B. von Kontoauszügen, führt zur Ablehnung des Antrags. Leben Sie (ggf. auch nur teilweise) vom Einkommen Ihres Ehepartners, sind dessen Verdienst- bzw. Steuerbescheid(e) vorzulegen. Dies erfolgt auch, um einen Anspruch auf Prozesskostenvorschuss/ Verfahrenskostenvorschuss zu prüfen. Der Wert von Vermögen ist durch Bewertungsgutachten oder Versicherungspolicen zu belegen. Allerdings darf das gerichtliche Verlangen nach Glaubhaftmachung nicht so weit gehen, dass von Ihnen das Einholen von Gutachten auf eigene Kosten verlangt werden darf (OLG Frankfurt a. M., 26.01.2010, 19 W 84/09).
Haben Sie kein Einkommen bzw. Vermögen, müssen Sie dem Gericht gegenüber glaubhaft machen, wie Sie Ihren Lebensunterhalt bestreiten. Auch eine eidesstattliche Versicherung zur Glaubhaftmachung Ihren Angaben kann von Ihnen verlangt werden.
Wie weit die Befugnisse des Gerichts bei der Ermittlung der tatsächlichen Umstände ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse gehen, ist nur teilweise geregelt (ZPO § 118 Abs 2). Wie im Gesetz beschrieben, können Urkunden eingefordert und Auskünfte eingeholt werden. Dazu kann jedwede Art von Akten eingesehen werden, auch ärztliche Gutachten oder Übersetzungen fremdsprachiger Unterlagen, oder es kann zu einer Inaugenscheinnahme kommen, auch in Form der Vorlage von Lichtbildern. Bestehen Unklarheiten Ihren Verdienst betreffend, kann auch bei Ihrem Arbeitgeber diesbezüglich nachgefragt werden. Dieser Form der Erhebung können Sie nicht widersprechen. Sie müssen aber dazu Gehör erhalten und Ihre Einverständnis geben. Falls Sie ihr Einverständnis verweigern, liegt es bei dem Gericht zu entscheiden, wie Ihre Weigerung gewertet wird. Möglich ist jedoch, dass Ihre Weigerung die Ablehnung Ihres PKH-Antrags nach sich zieht. Die Grenzen der Ermittlungsmöglichkeiten des Gerichts sind aber da erreicht, wo Zeugen oder Sachverständige geladen werden müssten. Auch ist davon auszugehen, dass es für das Gericht nicht zulässig ist, eigenständig Informationen bei Versicherungen, Sozialkassen und Finanzämtern einzuholen. Ein Amtsermittlungsverfahren zur Klärung Ihrer Einkommens- und Vermögenssituation darf das Gericht nicht einleiten.
Darstellung der Streitverhältnisse
Gesetzlich vorgeschrieben ist, dem Antrag auf Prozesskostenhilfe (PKH) bzw. Verfahrenskostenhilfe (VKH) eine Darstellung beizufügen, welche die Streitverhältnisse darlegt und gleichzeitig dazu die notwendigen Beweismittel zu benennen (ZPO § 117 Abs. 1, Satz 2). Anhand dieser Darstellung und der vorgebrachten Beweise wird das Gericht entscheiden, ob Ihr Antrag die zwingende Voraussetzung, Aussicht auf Erfolg zu haben, erfüllt (oder nicht).
Für den juristischen Laien liegt hier das größte Problem der Beantragung von PKH/VKH. Wie soll dies bewerkstelligt werden?
Theoretisch ist es möglich, mit eigenen Worten die Problematik zu benennen und anzugeben, auf welche Fakten sich die eigene Ansicht stützt und gleichzeitig Belege dafür zu erbringen. Möglich wäre dies z.B. im Fall eines bestehenden Unterhaltstitels, zu dessen Durchsetzung Sie eine Zwangsvollstreckung beantragen möchten oder bei einer einvernehmlichen Problematik, die gerichtlich entschieden werden muss. Unproblematisch ist ein eigener Versuch auch dahin gehend, dass es Ihnen direkt keinen Nachteil bringt, falls der Antrag aufgrund einer nicht hinreichenden Darstellung und/oder mangels Vorlage von hinreichenden Beweismitteln abgelehnt wird, da Sie den Antrag, so oft sie möchten, neu stellen können. Neue Anträge entfalten jedoch keine rückwirkende Wirkung. Daher wird die durch den ersten PKH/VKH-Antrag eingetretene Hemmung der Verjährung durch nachfolgende Anträge nicht verlängert (s.u. "PKH/VKH-Antrag und Verjährung der Hauptsache"). Somit kann es problematisch sein, wenn Fristen in dem Verfahren, für welches PKH/VKH beantragt werden soll, einzuhalten sind- Sie können daher mit mehreren Anträgen Gefahr laufen, dass Ihnen die Zeit für das Hauptsacheverfahren davon läuft. Auch Kosten, die Ihnen vor Wiederbeantragung entstanden sind, werden von einem ggf. erfolgreichen weiteren Antrag nicht gedeckt (s.a. Folgen einer Ablehnung - "wie oft" kann man einen PKH/VKH-Antrag stellen?").
Weiterhin müssen Sie bedenken, dass die Darstellung der Streitverhältnisse nicht unbeabsichtigt als unbedingte Klageerhebung missverstanden werden darf.
Auf Grund der uneinheitlichen Rechtslage bei der Bewilligung von PKH/VKH in Verbindung mit Ihrem Wunsch nach Rechtssicherheit wird es Ihnen leider praktisch kaum möglich sein, einen das Gericht überzeugenden Antrag zu formulieren, außer, Sie sind in der Lage, selbstständig einen Klageentwurf nach bzw. eine Berufungsbegründung nach zu verfassen. Die Verwendung von Mustern für einen Klageentwurf in der Art, wie Sie das möglicherweise von Musterverträgen oder -vereinabrungen kennen, ist nicht möglich. Wenn Ihnen die in den o.g. Paragrafen beschriebenen Vorgaben als Muster nicht ausreichen, kommen Sie leider nicht umhin, sich Hilfe bei einem Anwalt zu suchen.
Sich bei der Beantragung von PKH/VKH der Hilfe eines Anwalts zu bedienen ist auch weniger problematisch, als Sie vielleicht denken.
Einerseits können Sie sich für Ihren Erstkontakt mit einem Anwalt Ihrer Wahl einen Beratungshilfeschein beim Amtsgericht besorgen. Im Zuge dessen können Sie bereits in Erfahrung bringen, ob evtl. noch andere Hilfsmöglichkeiten für Ihr Problem bestehen, als Ihnen bisher bekannt war und gleichzeitig relativ unkompliziert eine Auskunft darüber erhalten, ob Ihre finanzielle Situation auch derart ist, dass Sie PKH/VKH erhalten könnten.
Andererseits besteht auch die Möglichkeit, sich bei einem Anwalt Ihrer Wahl für eine Erstberatung zu melden. Diese ist im Allgemeinen kostengünstiger, als einen Anwalt ohne Vorgespräch für das gesamte Verfahren zu verpflichten.
Weiterhin ist hier wichtig zu wissen, dass
- die Beantragung von PKH/VKH keine Gerichtsgebühren kostet;
- der Anwalt, der für Sie PKH/VKH beantragt, und sie dann auch im im eigentlichen Verfahren vertritt, für die PKH/VKH-Beantragung keine extra Kosten berechnen darf ( Nr. 2);
- in den Verfahren, in welchen am häufigsten PKH/VKH beantragt und genehmigt wird - nämlich bei Scheidung, Unterhalt, Umgangsrecht, Sorgerecht und bei Abstammungsrechtsfragen (Vaterschaftsanfechtung/ gerichtliche Vaterschaftsanerkennung) - wird PKH/VKH fast immer mit Anwaltsbeiordnug genehmigt. Ihre Anwaltskosten sind also durch die PKH/VKH mit abgedeckt.
Demzufolge können Sie sich, zumindest in Familien- und Abstammungssachen, direkt an einen Anwalt wenden, diesem Ihre Problematik, Ihre finanzielle Lage eingeschlossen, schildern und mit ihm alle Fragen direkt, offen und ehrlich besprechen. Bei keinem vertrauenswürdigen Anwalt werden Sie hier eine Kostenfalle zu befürchten haben. Sollten Sie keinen entsprechenden Anwalt bei sich vor Ort kennen, können Sie sich auch direkt an uns wenden.
.
Bitte zögern Sie nicht! Die eigenständige Beantragung von Verfahrenskostenhilfe ist voller Fallstricke. Kennen Sie diese nich, kann Ihr gesamtes, berechtigtes, Anliegen scheitern. Besonders der geforderte Antrag hat es in sich - er ist praktisch die Klageeinreichung und damit der Schlüssel zum Erfolg Ihres Verfahrens (oder auch zum Misserfolg). Auch ist der Antrag immer dann umso bedeutender, je höher der Streitwert ist. []
Bedenken bezüglich der Finanzierung des ersten Anwaltsbesuchs zur Besprechung des Verfahrens unter Zuhilfenahme von Verfahrenskostenhilfe sollten Sie nicht haben: Diese Konsultation wird mit über die Verfahrenskostenhilfe finanziert.
Möchten Sie das Finanzielle betreffend ganz sicher gehen, empfiehlt es sich, dass Sie selbstständig Beratungshilfe für diesen ersten Anwaltsbesuch beantragen.
• Kapitel "Erfolgsaussichten und Mutwilligkeit"
• Kapitel "Wer zahlt was? - PKH/VKH und Kosten"
• Kapitel "Der Antrag auf PKH/VKH"
• Kapitel "Das PKH/VKH-Prüfungsverfahren"
• Kapitel "Bewilligung - die Entscheidung über PKH und VKH"
• Kapitel "Überprüfung und Revision der PKH/VKH-Bewilligung - Mitteilungspflicht"
• Kapitel "Aufhebung der Bewilligung von PKH/VKH"
• Kapitel "Abgelehnter/abgewiesener PKH/VKH-Antrag: Beschwerde und Frist"
• Kapitel "PKH/VKH und Anwaltsbeiordnung sowie Anwaltswechsel"
• Kapitel "Verfahrenskostenhilfe (VKH) - PKH im Familienrecht"
• Kapitel "PKH für Verfahren außerhalb des Familienrechts"
• Kapitel "Gesetzestexte zu Prozesskostenhilfe (PKH) und Verfahrenskostenhilfe (VKH)"
• Kapitel "Urteile zu Prozesskostenhilfe (PKH) und Verfahrenskostenhilfe (VKH)"
• Kapitel "Bescheide PKH/VKH - Beispiele"
• Inhaltsverzeichnis