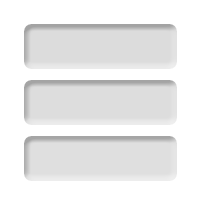Urteile zur Berechnung des anzusetzenden Mietkostenanteils bei Beantragung von PKH/VKH und Beratungshilfe
Behandlung der Stromkosten
Mietkostenaufteilung anhand der Einkommen aller Mitbewohner
OLG Koblenz, 03.07.1995, 7 W 233/95
Leitsätze:
- Leben in einer Wohnung (Unterkunft) mehrere Personen mit eigenem Einkommen, so sind für die Berechnung der Prozesskostenhilfe/Verfahrenskostenhilfe die Kosten der Unterkunft in der Regel nach Köpfen aufzuteilen, außer, es ist eine andere Aufteilung vereinbart.
- Ist das Einkommen eines Mitbewohners so niedrig, dass bei Abzug der Beträge nach ZPO § 115 Abs. 1, Satz 3, Nr. 1-4 kein oder ein fiktiv negatives einzusetzendes Einkommen verbleibt, wird das Einkommen dieses Mitbewohners nicht berücksichtigt. Dasselbe gilt, wenn das Einkommen eines Mitbewohners so erheblich unter dem Einkommen der anderen Mitbewohner zurückbleibt, dass ein Heranziehen dieses Bewohners zur Beteiligung an den Kosten der Unterkunft nicht angemessen erscheint.
- Zu den berücksichtigungsfähigen Kosten der Unterkunft zählen auch die mit dem Wohnen verbundenen Stromkosten.
Abgedruckt in: FamRZ 1997 679 ff., NJW-RR 1996 ff.
Kostenaufteilungsvereinbarungen zwischen Mitbewohnern sind wirkungslos
OLG Koblenz, 28.12.1999, 9 WF 760/99
Leitsatz:
- Lebt der Antragsteller in einer Mietwohnung mit seiner Lebensgefährtin zusammen, die kein wesentlich geringeres Einkommen als der Antragsteller bezieht, so ist die Wohnungsmiete bei der Errechnung des Einkommens des Antragstellers nur zur Hälfte zu berücksichtigen. Daran ändert nichts, dass der Antragsteller mit der Lebensgefährtin vereinbart hat, für die Miete alleine aufzukommen.
Abgedruckt in: MDR 2000 728 ff.
Kostenaufteilung auf Mitbewohner nur auf Basis realer Einkünfte
OLG Köln, 17.02.2003, 14 WF 22/03
Leitsätze:
- Die Berechnung von Prozesskostenhilfe/Verfahrenskostenhilfe darf nur auf Grundlage der eigenen Einkünfte des Antragsstellers beruhen, nicht auf dem Einkommen andere, wie zum Beispiel Ehegatten.
- Der Anteil eines Mitbewohners an den Wohnkosten darf nur auf Grundlage seines wirklichen Einkommes berechnet werden. Fiktives Einkommen darf keinem Mitbewohner angerechnet werden.
Aus dem Urteil (gekürzt):
Ein Antragsteller hatte Verfahrenskostenhilfe beantragt. Genehmigt wurde Ihm Verfahrenskostenhilfe mit Ratenzahlung. Dagegen wandte sich der Antragsteller mit der Begründung, dass bei der Berechnung seines Anteils an den Wohnungskosten sein Anteil an den zu zahlenden Kosten zu gering angesetzt wurde. Daher kann er die Raten nicht bezahlen.
Der Antragsteller lebt mit seiner Ehefrau zusammen. Bei der Berechnung des Anteils des Antragsstellers an den Wohnkosten wurde tatsächlich nicht das wirkliche Einkommen seiner Ehefrau, sondern ein höheres, fiktives, Einkommen als Berechnungsgrundlage herangezogen.
Nach § 115 Abs. 1 Satz 1 ZPO hat die Partei, die Prozesskostenhilfe beantragt, "ihr Einkommen einzusetzen", d. h. alle Einkünfte in Geld und Geldeswert. Maßgebend ist dabei nach herrschender Meinung aber nur das Einkommen der antragstellenden Partei selbst, nicht auch das Familieneinkommen. Denn würde das Einkommen des anderen Ehegatten mitberücksichtigt, so würde dies im Ergebnis darauf hinauslaufen, dass der Ehegatte die Prozesskosten letztlich mitzutragen hätte, obwohl er dazu nicht verpflichtet ist.
Darüber hinaus bedeutete die Mitheranziehung der Ehefrau im vorliegenden Fall, dass ihr fiktive Erwerbseinkünfte zugerechnet würden. Unterlassener Arbeitseinsatz aber ist schon bei der Partei, die Prozesskostenhilfe beantragt, nicht schlechthin zu berücksichtigen, sondern nur im Einzelfall, wenn ohne weiteres auf eine nach dem Arbeitsmarkt mögliche Arbeitsaufnahme verwiesen werden kann. Für den Ehegatten, für den es nicht um staatliche Mittel für zukünftige Prozesskosten geht, kommt dagegen eine derartige erweiternde Auslegung von § 115 ZPO nicht in Betracht.
Soweit ursprünglich darauf abgestellt wurde, die Ehefrau des Beklagten müsse und könne jedenfalls soviel dazu verdienen, dass sie sich jedenfalls an den Wohnkosten beteiligen könne, führt auch das zu keinem anderen Ergebnis. Grundsätzlich sind zwar die Wohn/Mietkosten im Verhältnis der Bewohner zu teilen - insoweit wirkt sich das Einkommen des anderen Ehegatten ausnahmsweise doch auf das PKH-Verfahren aus. Die Beteiligung an den Wohnkosten kann aber nur soweit gehen, wie tatsächlich Einkünfte des anderen Ehegatten dazu zur Verfügung stehen; anderenfalls liefe es wiederum auf die oben bereits abgelehnte Zurechnung fiktiven Einkommens des am Verfahren nicht beteiligten Ehegatten hinaus.
Mangels einsatzfähigen Einkommens des Beklagten ist die Anordnung von Ratenzahlung folglich aufzuheben.
Quelle:
.
Bitte zögern Sie nicht! Die eigenständige Beantragung von Verfahrenskostenhilfe ist voller Fallstricke. Kennen Sie diese nich, kann Ihr gesamtes, berechtigtes, Anliegen scheitern. Besonders der geforderte Antrag hat es in sich - er ist praktisch die Klageeinreichung und damit der Schlüssel zum Erfolg Ihres Verfahrens (oder auch zum Misserfolg). Auch ist der Antrag immer dann umso bedeutender, je höher der Streitwert ist. []
Bedenken bezüglich der Finanzierung des ersten Anwaltsbesuchs zur Besprechung des Verfahrens unter Zuhilfenahme von Verfahrenskostenhilfe sollten Sie nicht haben: Diese Konsultation wird mit über die Verfahrenskostenhilfe finanziert.
Möchten Sie das Finanzielle betreffend ganz sicher gehen, empfiehlt es sich, dass Sie selbstständig Beratungshilfe für diesen ersten Anwaltsbesuch beantragen.
[ weiter ]
• Kapitel "Einkommen bei PKH, VKH und Beratungshilfe"
• Kapitel "Vermögen bei PKH, VKH und Beratungshilfe"
• Kapitel "Pkw/Auto bei PKH, VKH und Beratungshilfe"
• Kapitel "Prozess- und Verfahrenskostenvorschuss bei PKH und VKH"
• Kapitel "Rechner für PKH, VKH und Beratungshilfe"
• Kapitel "Gesetzestexte zu Einkommen und Vermögen bei PKH, VKH und Beratungshilfe"
• Kapitel "Urteile zur Einkommesberechnung PKH, VKH und Beratungshilfe"
• Kapitel "Urteile zum Vermögen bei PKH, VKH und Beratungshilfe"
• Inhaltsverzeichnis